Buchkritik „Stern 111“ von Lutz Seiler
In diesem Jahr kam der Roman „Stern 111“ von Lutz Seiler heraus, der seltsame Titel ist der Name eines Radio-Modells.
Es sind die Monate zwischen der Noch-DDR und der Noch-nicht-ganz-BRD, in denen der Roman angesiedelt ist. In diesem Interregnum ist vieles möglich, weil die alte Staatsmacht zerbröckelt und die neue noch nicht gefestigt ist.
Hier kann man in Ostberlin illegal Taxi fahren, illegal wohnen und eine illegale Kellerkneipe betreiben. Alle drei Dinge tut der Hauptprotagonist Carl.
Aus der DDR-Provinzstadt Gera gehen bzw. fliehen Walter und Inge Bischoff 1989 in den Westen. Als Nachhut zurück bleibt ihr Sohn Carl, der das Fehlen seiner beiden Eltern möglichst lange kaschieren soll.
Doch Carl hat nach ein paar Wochen genug und geht Ostberlin. Von dem Ortswechsel verspricht er sich den Beginn seiner Lyriker-Laufbahn. Denn Carl ist zwar ein ausgebildeter Maurer, aber gleichzeitig ist er auch Dichter.
In Berlin gerät er „[...] in die entlegensten, finsteren Hinterhöfe hineinwuchernde Wildnis aus Kneipen, Kaschemmen, Wohnzimmern mit Ausschank und Gelegenheitstresen.“ (Seite 361)
Er schließt sich dem „Rudel“ der „Assel“ an.
Die ostdeutsche Szene von Hausbesetzer*innen bilden im noch geteilten Berlin ein „Imperium der Guten“ und eine „Aguerilla“, was für „Arbeiterguerilla“ steht. Die Besetzer*innen rüsten sich für eine Übernahme des Westens und die Verteidigung der neu gewonnenen Freiheit. Die einzelnen besetzten Häuser werden dabei von Gebäude-„Kapitänen“ verwaltet. Der Hirte „Hoffi“ schmiedet die Pläne dazu. Doch an diesen ist Carl gar nicht so sehr interessiert. Er beginnt eine Affäre mit Effi, die eigentlich Ilonka Kalasz heißt und ihren Sohn Freddy allein erzieht.
Während Carl in der „Assel“ am Tresen steht, versuchen seine Eltern – zeitweise getrennt voneinander – ihr Glück im Westen.
Erst nach 16 Monaten trifft Carl dann wieder mit seinen Eltern zusammen und diese erklären ihm, warum sie so schnell aus der damals noch existierenden DDR auswanderten.
Lutz Seilers Roman ist voller poetischer Sprache und an manchen Stellen surealistisch, ähnlich wie Seilers Roman „Kruso“.
„Oft trugen die jungen Mütter auf ihrer überheizten Etage nicht mehr als große, verwaschene T-Shirts oder weiträumige Männerhemden, sogenannte Großvaterhemden (eine Art Vorkriegsware, erkennbar am Stoff, an den doppelten Nähten, der guten Verarbeitung), die über den Hüften halbrund ausgeschnitten waren und befleckt mit den vertrockneten Resten irgendeiner Kindernahrung, manchmal auch mit den frischen dunklen Inseln ausschießende Milch; an ihren Füßen flappten Badelatschen.“ (Seite 195)
Allerdings wird er nicht so wirr wie „Kruso“ auf den letzten 100 Seiten.
Trotzdem muss man Seilers Stil mögen, um auch seinen neuesten Roman genießen zu können. Wer auf der Suche nach Action und Spannungskurve ist, die/der liegt bei „Stern 111“ eher falsch. Wer aber einen verzauberten Blick in das Interregnum 1989/90 in Ostberlin werfen will, ist hier richtig.
Lutz Seiler: Stern 111, Ulm 2020.



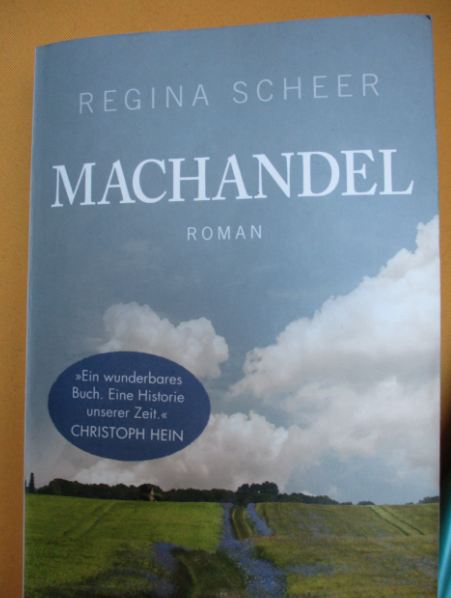

Kommentare
Kommentar veröffentlichen